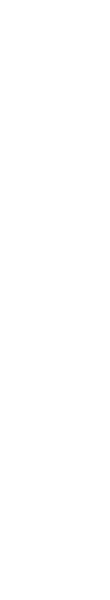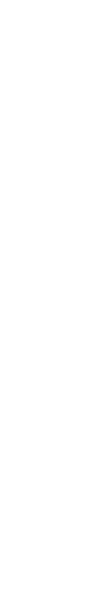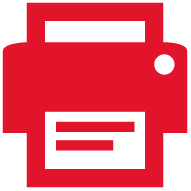Die verlorene Melodie
Mo 16.06.2025, 11.00 - 12.00 Uhr
Besetzung

Musikalische Leitung
Holly Hyun Choe
Dirigentin
Holly Hyun Choe
Holly Hyun Choe, in Südkorea geboren und in Los Angeles aufgewachsen, beeindruckt mit Präsenz und Strahlkraft auf dem Podium. Nach zweijähriger Tätigkeit als Assistenzdirigentin des Tonhalle-Orchesters unter der Leitung von Paavo Järvi ist sie weiterhin eine gern gesehene Gastdirigentin in den Vereinigten Staaten und Europa.
Inzwischen lebt sie in Deutschland und geht 2024/25 in ihre dritte Spielzeit als Erste Dirigentin des Kammerorchesters Ensemble Reflektor, das sich als Botschafter einer grenzenlosen Musikkultur versteht. Des Weiteren ist sie seit vergangener Saison für drei Jahre als Artiste associée mit dem Orchestre de Chambre de Genève verbunden, das sie im April 2025 sowohl im Konzert als auch mit Gerald Barrys Oper Alice's Adventures Under Ground am Grand Théâtre de Genève dirigiert.
Ein wichtiges Debüt in ihrer Heimatstadt sticht aus den Engagements der aktuellen Saison heraus: Im Mai 2025 dirigiert Holly Hyun Choe erstmals das Los Angeles Philharmonic. Im Rahmen des Dudamel Fellowships arbeitet sie dort darüber hinaus an der Seite von Gustavo Dudamel, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Xian Zhang, Natalie Stutzmann und Philippe Jordan. Ein weiteres Debüt führt sie zum Norwegian Radio Orchestra, wo sie unter anderem Kaija Saariahos Ciel d’hiver sowie Tschaikowskis 4. Sinfonie dirigiert. Zudem kehrt sie nach erfolgreichen Sommerkonzerten mit dem Schleswig-Holstein Festivalorchester zurück zum Tonhalle-Orchester Zürich, zum Orchestre de Paris (hier steht unter anderem Schostakowitsch‘ 9. Sinfonie auf dem Programm), zum Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und zur Kammerakademie Potsdam, mit der sie auch in München und Essen gastiert. In den vergangenen Spielzeiten dirigierte sie außerdem unter anderem das Deutsche Symphonieorchester Berlin, das Estonian National Symphony Orchestra und das Odense Symphony Orchestra.
Im Rahmen ihres Anliegens, Komponistinnen zu fördern, programmiert Holly Hyun Choe regelmäßig Werke von Ethel Smyth, Clarice Assad, Grażyna Bacewicz, Lili Boulanger, Britta Byström, Louise Farrenc, Fanny Hensel, Jennifer Higdon, Jessie Montgomery, Emilie Mayer, Caroline Shaw, Dobrinka Tabakova, Anna Thorvaldsdottir und Galina Ustvolskaya.
Holly Hyun Choe hat 2023 ihr Studium bei Prof. Johannes Schlaefli an der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen. Ihre musikalische Reise begann sie autodidaktisch: Als 13-Jährige erlernte sie das Klarinettenspiel; ihren ersten Einzelunterricht auf dem Instrument erhielt sie erst im Alter von 19 Jahren. 2015 belegte sie ein Masterstudium bei Prof. Charles Peltz am New England Conservatory. Sie besuchte Meisterklassen von Bernhard Haitink, Jorma Panula, Peter Eötvös, Sylvia Caduff und Jaap van Zweden und hat Esa-Pekka Salonen (Orchestre de Paris), Fabio Luisi (Concertgebouw Orkest), Leonard Slatkin (Orchestre national de Lyon), Simone Young (Orchestre de Chambre de Lausanne/Opernhaus Zürich), und Karina Canellakis (Gürzenich-Orchester Köln) assistiert.
2018 wurde sie in die Förderung Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates aufgenommen; des Weiteren wurde sie durch einen Career Assistance Award der Solti Foundation - U.S., ein Stipendium des Taki Alsop Conducting Fellowship und im Mentoringprogramm der Peter Eötvös-Stiftung gefördert.
Stücke
Foto: (c) Emily Turkanik

Sprecher
Julian Greis
Sprecher
Julian Greis
Julian Greis, 1983 in Hattingen geboren, studierte nach seinem Abitur von 2003 bis 2006 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. In dieser Zeit spielte er bereits als Gast am Landestheater Esslingen und Düsseldorfer Schauspielhaus. Für seine Rollen in "Merlin oder Das wüste Land" erhielt er 2006 den Solo- und Ensemblepreis des Schauspielschultreffens. Nach dem Studium bekam er ein Festengagement am Schauspielhaus Graz bei Anna Badora, wo er u. a. mit Viktor Bodó, Tom Kühnel und Christina Rast arbeitete. Mit der Intendanz Joachim Lux kam er ans Thalia Theater und arbeitete u. a. mit den Regisseur*innen Antú Romero Nunes, Kornél Mundruczó, Christopher Rüping und Jette Steckel. Im Dezember 2012 wurde ihm der Boy-Gobert-Preis für Nachwuchsschauspieler der Hamburger Bühnen verliehen und im Oktober 2014 wurde er für "Moby Dick" (Regie Antú Romero Nunes) gemeinsam mit seinen Kollegen mit dem Rolf-Mares-Preis als „Bester Darsteller“ ausgezeichnet. Julian Greis ist seit der Spielzeit 2009/10 festes Ensemblemitglied am Thalia Theater. Er arbeitet zudem als erfolgreicher Sprecher für Hörbücher und Hörspiele und erhielt 2017 sowie 2018 den Deutschen Kinderhörbuchpreis BEO als Bester Interpret.
Stücke
Foto: Julia Schwendner

Musiker:innen des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg
Musiker:innen des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg
Das Philharmonische Staatsorchester ist Hamburgs größtes und ältestes Orchester und blickt zurück auf einen langen musikalischen Werdegang. Als 1934 das „Philharmonische Orchester“ und das „Orchester des Hamburgischen Stadttheaters“ fusionierten, trafen zwei traditionsreiche Klangkörper aufeinander. Bereits seit 1828 wurden Philharmonische Konzerte in Hamburg gespielt, Künstler wie Clara Schumann, Franz Liszt und Johannes Brahms waren regelmäßige Gäste der Philharmonischen Gesellschaft. Die Historie der Oper reicht noch weiter zurück: seit 1678 gibt es in Hamburg Musiktheater, wenngleich sich ein festes Opern- bzw. Theaterorchester erst später konstituierte. Bis heute prägt das Philharmonische Staatsorchester den Klang der Hansestadt, ist Konzert- und Opernorchester in einem.
In seiner langen Geschichte traf das Orchester auf große Künstlerpersönlichkeiten wie Telemann, Tschaikowsky, Strauss, Mahler, Prokofjew oder Strawinsky. Seit dem 20. Jahrhundert prägten Chefdirigenten wie Karl Muck, Joseph Keilberth, Eugen Jochum, Wolfgang Sawallisch, Horst Stein, Hans Zender, Christoph von Dohnányi, Gerd Albrecht, Ingo Metzmacher oder Simone Young den Klang der Philharmoniker. Bedeutende Kapellmeister der Vorkriegszeit wie etwa Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Karl Böhm oder Hans Schmidt-Isserstedt brillierten ebenso am Pult wie herausragende Dirigenten unserer Tage: Christian Thielemann, Semyon Bychkov, Kirill Petrenko, Sir Neville Marriner, Valery Gergiev, Marek Janowski oder Sir Roger Norrington.
Seit 2015 ist Kent Nagano Hamburgischer Generalmusikdirektor sowie Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters und der Staatsoper Hamburg. Zu seinem Amtsantritt initiierte Nagano mit der „Philharmonischen Akademie“ ein neues Projekt, das den Auftakt zur jeweils neuen Opern- und Konzertsaison bildet und neben besonderen Spielorten auch ein großes Open-Air-Konzert auf dem Hamburger Rathausmarkt umfasst. 2016 waren Nagano und die Philharmoniker auf Südamerika-Tournee, 2019 folgten Konzertreisen nach Spanien und Japan. Seit 2017 führt Kent Nagano mit dem Philharmonischen Staatsorchester die traditionsreichen Philharmonischen Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie fort, zu deren Eröffnung das Oratorium ARCHE bei Jörg Widmann in Auftrag gegeben und uraufgeführt wurde. Der Konzertmitschnitt ist bei ECM erschienen; Widmann erhielt dafür den OPUS KLASSIK als Komponist des Jahres 2019.
Das Philharmonische Staatsorchester gibt pro Saison insgesamt rund 35 Konzerte in Hamburg und spielt über 240 Vorstellungen der Staatsoper Hamburg und des Hamburg Ballett John Neumeier. Damit ist es Hamburgs meistbeschäftigter Klangkörper. Die stilistische Bandbreite der 140 Musiker, die von historisch informierter Aufführungspraxis bis hin zu den Werken unserer Zeit reicht und sowohl Konzert- als auch Opern- und Ballettrepertoire umfasst, sucht in Deutschland ihresgleichen.
Auch Kammermusik hat bei den Philharmonikern eine lange Tradition: Was 1929 mit einer Konzertreihe für Kammerorchester begann, wurde seit 1968 durch eine reine Kammermusikreihe fortgesetzt.
2008 wurden die damalige Generalmusikdirektorin Simone Young und das Philharmonische Staatsorchester mit dem Brahms-Preis der Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Auf CD liegen ein kompletter Wagner-Ring sowie sämtliche Symphonien von Brahms und Bruckner vor – letztere in den selten gespielten Urfassungen – sowie Werke von Mahler, Hindemith, Berg und DVDs mit Opern- und Ballettproduktionen von Hosokawa, Offenbach, Reimann, Auerbach, Bach, Puccini, Poulenc und Weber.
Der musikalischen Tradition der Hansestadt fühlen sich die Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters ebenso verpflichtet wie der künstlerischen Zukunft Hamburgs. Bereits seit 1978 besuchen die Musikerinnen und Musiker regelmäßig Hamburger Schulen. Heute betreibt das Orchester ein breit gefächertes Education-Programm, das Schul- und Kindergartenbesuche, musikalische Patenschaften, Kindereinführungen, Familienkonzerte und Orchesterproben für Schulklassen beinhaltet und in der eigenen Orchesterakademie junge Musiker auf den Beruf vorbereitet. Damit leisten die Philharmoniker mit viel Spaß an der Sache einen wertvollen Beitrag zur musikalischen Nachwuchsarbeit in der Musikstadt Hamburg.
Stücke
- 3. Akademiekonzert
- Dollhouse
- PhiSch - das Staatsorchester hautnah...
- Die Illusionen des William Mallory
- Die verlorene Melodie
- IM.PRO.LOG
- Die Gänsemagd
- 1. Blaues Konzert
- 2. Blaues Konzert
- Die Unruhenden
- Peter und der Wolf von St. Pauli
Foto: Foto: Felix Broede

Mitglieder des Landesjugendorchesters Hamburg
Mitglieder des Landesjugendorchesters Hamburg
Das 1968 als Landesjugendorchester der Freien und Hansestadt Hamburg gegründete Hamburger Jugendorchester (LJO), ist eines der ältesten Landesjugendorchester der Bundesrepublik.
In den 60er Jahren existierten nur einige Schul- und Musikschulorchester. Vor diesem Hintergrund ergriff das Amt für Jugend die Initiative, für die musikinteressierten Jugendlichen ein Sinfonieorchester ins Leben zu rufen, das darüber hinaus eine musikalische Herausforderung für die Jugendlichen darstellen sollte. Ein erster Orchesterkurs fand statt im Jahre 1966, scheiterte jedoch an der Literatur, die die spieltechnischen Möglichkeiten der Jugendlichen überschritt. Auch der Dirigenten hatte hinsichtlich der Probenarbeit mit Laien oder angehenden Profis keine Erfahrung.
Für die teilnehmenden Jugendlichen wurden diese Erfahrungen zum Anstoß darüber nachzudenken, wie sie sich ein sinfonisches Orchester vorstellten: wöchentliche Proben und die Festlegung der Programme und des Dirigenten durch die Orchestermitglieder waren die Hauptpunkte. Die Jugendlichen wünschten, die Organisation des Orchesters selbst in den Händen zu haben und wandten sich mit diesen Vorstellungen an das Amt für Jugend. Die Behörde begrüßte die Ideen der Jugendlichen, neben der künstlerisch anspruchsvollen Ausbildung einen Schwerpunkt auf den jungendpflegerischen Aspekt dieser Gemeinschaft zu legen, in Form der Selbstverwaltung.
Mit der Vision eines sich selbst verwaltenden Jugendorchesters wurde im Jahre 1968 das HJO als Landesjugendorchester gegründet. Das Amt für Jugend stellte die finanziellen Mittel zur Verfügung und erarbeitete gemeinsam mit den Jugendlichen die Struktur des Orchesters; die erste Geschäftsordnung wurde 1970 verabschiedet.
Ein selbstverwaltetes Orchester war ein Novum in der deutschen Orchesterlandschaft. Ein vom Orchester gewählter Vorstand sollte für alle Belange zuständig sein. Nachdem die ersten Rahmenbedingungen geschaffen waren, zeigte erst die kontinuierliche Arbeit, welche Aufgaben für das Orchester lebensnotwendig sind. Dem Bedarf entsprechend wurden an die einzelnen Vorstandsämter bestimmte Aufgabenfelder geknüpft.
Erster Dirigent des Hamburger Jugendorchesters war der an der Musikhochschule studierende Herbert Bruhn, der mit Matthias Rieger das „Altonaer Kammerorchester“ gegründet hatte; sie waren zusammen mit den Mitgliedern ihres Orchesters maßgeblich an der Gründung des HJO beteiligt.
Herbert Bruhn gehörte der Dirigierklasse von Professor Wilhelm Brückner-Rüggeberg an, der als Mentor für das junge Orchester gewonnen werden konnte. In dieser Eigenschaft beriet er das Jugendorchester bei der Neuwahl der Dirigenten und führte gelegentlich den Taktstock.
1983 wechselte die Trägerschaft vom Amt für Jugend zur Kulturbehörde. Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Mitglieder auf derzeit etwa 80 junge Musiker. Für die Probenarbeit entwickelte sich eine regelmäßige Betreuung durch erfahrene Musiker der Berufsorchester. Zusätzlich zur regulären Probenarbeit, der Einstudierung dreier Sinfonieprogramme jährlich, organisieren die Jugendlichen Kammermusikprojekte und Konzertreisen.
Mit zunehmendem Niveau der musikalischen Vorbildung und den instrumentalen Fähigkeiten der Jugendlichen, ihrem wachsenden musikalischen Anspruch, widergespiegelt in Wahl und Präsentation der Konzertprogramme, etablierte sich das Hamburger Jugendorchester im Hamburger Musikleben; es folgten gemeinsame Projekte mit Chören und der Hamburger Musikhochschule. Das Orchester spielte bei Messe- und Kongreßeröffnungen, war zwischen 1989 und 1995 eingeladen, neben renommierten Profiorchestern beim Hamburger Musikfest aufzutreten und gastierte als Repräsentant der Stadt bei den Hamburger-Tagen in Danzig, Marseille und Prag.
Trotz der für Jugendorchester üblichen hohen Fluktuation und den gesteigerten Anforderungen, in musikalischer wie in organisatorischer Hinsicht, hat die demokratische Struktur bis heute Bestand; lediglich die Zahl der Ämter und ihre Profile ändern sich den wachsenden Aufgaben des Orchesters und dem Anspruch der Jugendlichen entsprechend.
Im Jahr 2005 benannte sich das Orchester in “Landesjugendorchester Hamburg” um, um seinen Status des Orchesters als Auswahlorchester der Stadt Hamburg zu betonen.
2007 wechselte die Trägerschaft des Orchesters von der Kulturbehörde zum Landesmusikrat Hamburg. Im Zuge dieses Wechsels wurde auch die Organisationsstruktur maßgeblich verändert: Von nun an war das Landesjugendorchester ein Projekt des Landesmusikrats. Die dadurch neu gegebenen Rahmenbedingungen hatten insbesondere einige Einschränkungen für die Selbstverwaltung des Orchesters zufolge, jedoch wurde die Selbstverwaltung im Rahmen einer gemeinsam erarbeiteten Geschäftsordnung weitestgehend erhalten.
2018 feierte das Landesjugendorchster Hamburg sein 50 jähriges Jubiläum.